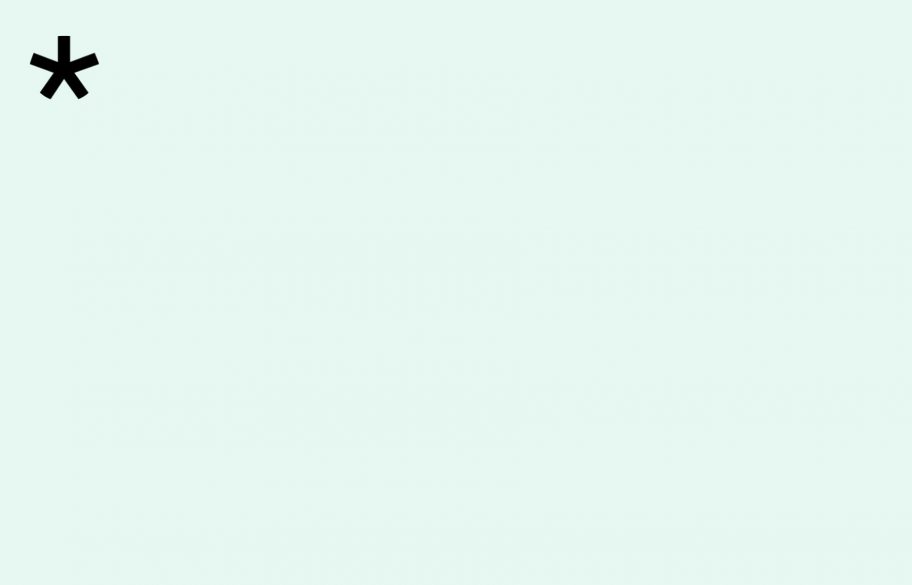Neuseeland, Literatur, 2015
Lloyd
Jones

Neuseeland ist ein junges Land, hat allerdings bis zur Erlangung seiner endgültigen Unabhängigkeit im Jahre 1947 zahlreiche und oftmals gewaltvolle Besiedelungs- und Einwanderungswellen durchleben müssen. Die wechselhaften Geschicke der Geschichte und die fließenden Übergänge von Identität und Zugehörigkeit sind der DNA seiner Bewohner also unmittelbar eingeschrieben.
Das gilt auch für den neuseeländischen Schriftsteller Lloyd Jones, der 1955 in Lower Hutt, nahe Wellington, zur Welt kam. Zwar scheint er sich mit seinen thematisch abwechslungsreichen Romanen immer wieder neu zu erfinden, doch geht es in deren innerstem Kern fast immer um die entscheidende Frage: Wer sind wir? Was und wer entscheidet über die stets vagen und oftmals erratischen Umrisse unserer Identität? Und: Wie verhandelt man wiederum als Schriftsteller diese Frage in einem Roman? Er selbst kam über den Umweg des Journalismus zur Literatur. Nach einem Studium der Politikwissenschaft an der Victoria University von Wellington bereiste Lloyd Jones erst einmal als Korrespondent und Reporter Asien, Europa und die USA. 1985 debütierte er mit der schwarzhumorigen Prosa „Gilmore’s Diary“ (Gilmores Milchladen), dem Porträt eines jungen Mannes in Konflikt mit den Traditionen seines neuseeländischen Heimatdorfes. Fortan erschienen in regelmäßiger Folge Bücher, die jedes Mal inhaltlich wie formal aufs Neue überraschten: so etwa 1988 der Erzählband „Swimming to Australia“ (Schwimmen nach Australien) und 1991 die romanhafte Reiseerzählung „Der Mann, der Enver Hodscha war“. Diese verdankt sich einer Reise, die den Autor 1991 nach Albanien geführt hat. Doch obwohl das Buch auf vor Ort recherchierten Fakten basiert, ist es nichts weniger als eine genuine Fiktion über das erfundene Double des einstigen gestürzten Diktators Enver Hoxha, das sich in dieser Variante der Geschichte der eigenen Lebensgeschichte beraubt. Der 2000 veröffentlichte Roman „The Book of Fame“ (Das Buch vom Ruhm) folgt den Spuren der neuseeländischen Rugby-Nationalmannschaft „The Blacks“ auf ihrem legendären historischen Siegeszug durch Europa im Jahr 1905; in „Hier, am Ende der Welt, lernen wir tanzen“, das im Original 2002 erschien, wendet er sich dem Milieu des argentinischen Tangos zu. Der Roman verbindet dabei zwei Liebesgeschichten über Zeiten und Kontinente hinweg. Die Handlung setzt ein gegen Ende des Ersten Weltkriegs in Neuseeland, wo die junge Louise Cunningham den Klavierstimmer Paul Schmidt kennen- und von ihm das Tangotanzen lernt. Als Schmidt aufgrund seines Namens verdächtigt wird, ein Deutscher zu sein, muss er fliehen. Sie folgt ihm – bis nach Buenos Aires. Jahrzehnte später macht sich Schmidts Enkelin Rosa, auch sie eine begeisterte Tango-Tänzerin, auf den Weg, um den Spuren ihres Großvaters zu folgen, und wird sich ebenfalls bei einem Tango verlieben. Ein Happy End hat der Schriftsteller übrigens nicht in petto; einfache Erklärungsmuster lehnt er entschieden ab. Dies bewies Lloyd Jones spätestens mit seinem preisgekrönten Roman „Mister Pip“ (2006), der ihm endgültig den verdienten internationalen Durchbruch verschaffte (und mittlerweile als das erfolgreichste neuseeländische Buch aller Zeiten gilt). Er spielt in Bougainville, einem kleinen Dorf in Papua-Neuguinea, vor dem Hintergrund des dortigen Bürgerkriegs in den 1990er Jahren, den der Autor als Journalist vor Ort miterlebt hat. Es ist ein so fabelhafter wie herzzerreißender Roman – und eine Parabel von tiefer Humanität. Sie handelt von Mr. Watts, dem letzten Weißen in dem Dorf, der den von Gewalt traumatisierten Kindern mithilfe von Charles Dickens nicht nur die sinnstiftende Kraft der Literatur, sondern auch von Werten wie Menschlichkeit und Mitgefühl beibringt. Wenn dabei die Grenzen von Realität und Fiktion immer mehr verschwimmen (da Mr. Watts unter dem Decknamen der Dickensschen Figur „Mr. Pip“ zu einem von den Soldaten gesuchten Rebellen wird), wandelt sich Mr. Watts selbst zu einer männlichen Sheherazade unserer Tage, mit deren Hilfe Lloyd Jones die überkommenen Muster des postkolonialistischen Diskurses hybridisiert und überwindet. Manichäische Denkmuster und Deutungen unterläuft der Schriftsteller – der in seiner Prosa die lyrische Note ebenso beherrscht wie etwa die unterschiedlichen Register einer plastischen Mündlichkeit – auch in „Die Frau im blauen Mantel“ (2012), der 2010 im englischen Original erschien. Darin erzählt er von der Reise einer fiktiven jungen Afrikanerin, die sich illegal von Tunesien nach Deutschland durchschlägt, um dort ihren vom Kindsvater entführten Sohn zu suchen. Was die junge Frau auf dieser langen Reise erlebt, erzählt Lloyd Jones in erschreckend plastischen Szenen: Wie sie sich verkaufen muss, auch sexuell, um ihr Ziel zu erreichen. Wie sie als Freiwild gilt, nur weil sie schwarz, eine Frau und illegal ist. Aber auch, wie ihr geholfen wird – und wie sie noch diejenigen, die ihr helfen, zu belügen und bestehlen scheint. Scheint – denn Jones schildert die Geschichte der Frau nicht nur aus der Rückschau, als sie des Mordes verdächtig längst schon wieder in Italien im Gefängnis sitzt. Er entfaltet das Geschehen vor allem multiperspektivisch gebrochen: Zuerst lässt er all jene zu Wort kommen, denen sie auf ihrer Reise begegnet ist – unter anderem ein Lastwagenfahrer, eine Gruppe von Jägern, ein Straßenkünstler, eine Dokumentarfilmerin. Erst ganz am Ende des Romans gibt die Frau selbst ihre Version der Geschichte zum Besten. Der Effekt ist verblüffend: Wie in einem Mosaik fügen sich die einzelnen Teile über die Identität dieser Frau langsam aber sicher zusammen – und es wird klar, dass es keine alleingültige Wahrheit gibt. Geschickt spiegelt also die dossierartige Form des Romans das Grunddilemma der Papierlosen: Sie sind, was wir in ihnen sehen wollen. Nie aber sind sie bei Lloyd Jones nur Opfer und nur Täter, nur gut oder nur böse. Der Kindsvater ist kein rassistischer Weißer, sondern ein Schwarzer aus Deutschland, der sich selbst in seiner Haut nicht heimisch fühlt. Die Frau wiederum lehnt die Rolle des Opfers ebenso bewusst ab wie unser Mitleid: Nur weil sie schwarz und ein Flüchtling aus Afrika ist, ist sie nicht per se ein besserer Mensch. Lloyd Jones Romane machen es uns also schwer und leicht zugleich: Es ist ein Leichtes, ihrer sprachgewaltigen Fabulierlust zu erliegen. Ihre Vielschichtigkeit aber erfordert genaueste Lektüre.
Text: Claudia Kramatschek
Kamera/Schnitt: Uli Aumüller, Sebastian Rausch
Der Mann, der Enver Hodscha war. Roman. Aus dem Englischen von Grete Osterwald. Hanser Verlag, München / Wien 1994.
Mister Pip. Roman. Aus dem Englischen von Grete Osterwald. Rowohlt Verlag, Hamburg 2008.
Die Frau im blauen Mantel. Roman. Aus dem Englischen von Grete Osterwald. Rowohlt Verlag, Hamburg 2012.
Hier, am Ende der Welt, lernen wir tanzen. Roman. Aus dem Englischen von Grete Osterwald. Rowohlt Verlag, Hamburg 2014.